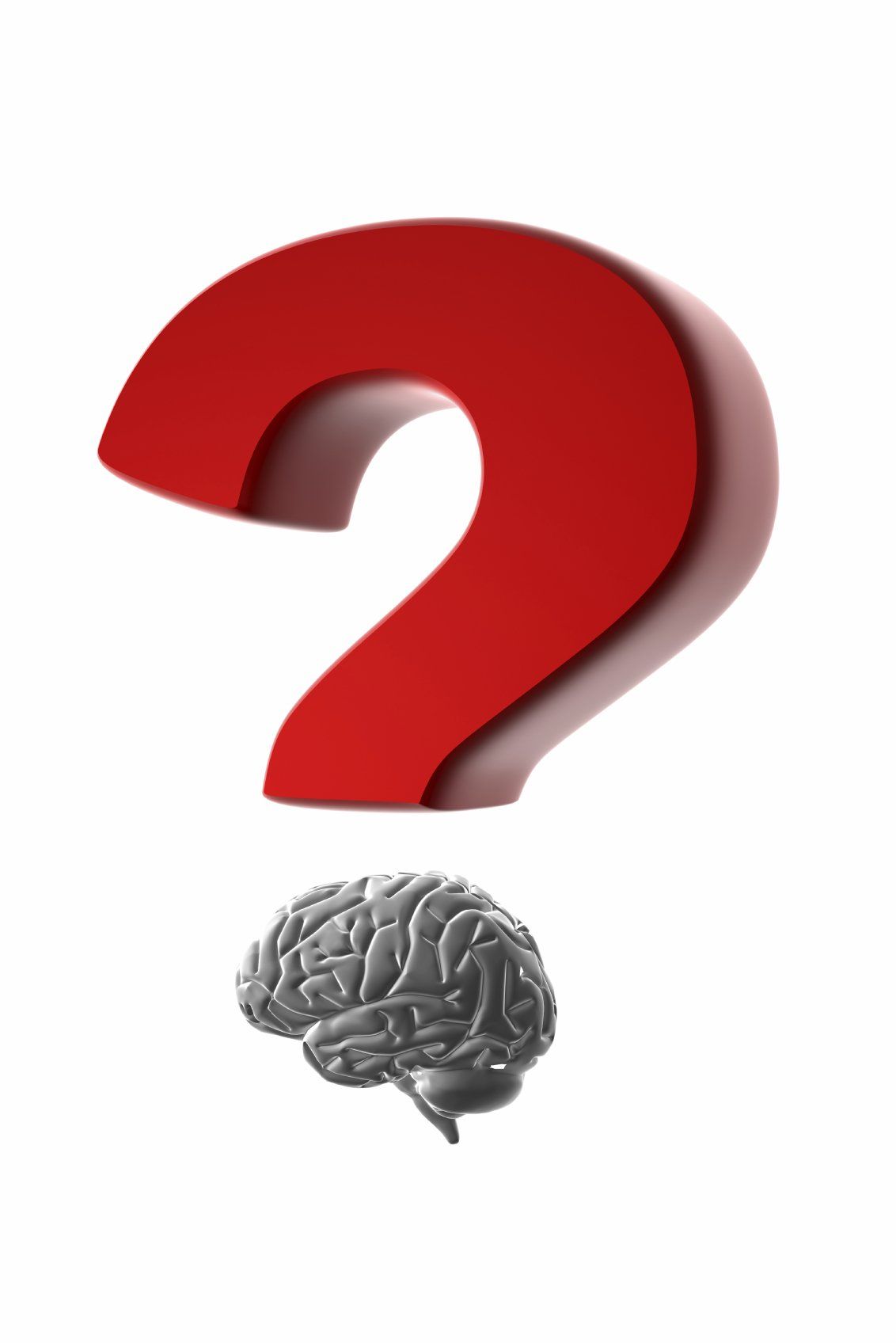First things first: Was ist ADHS überhaupt?
ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (englisch ADHD = Attention Deficit/Hyperactivity Disorder). Die Störung beginnt immer im Kindesalter (vor dem 12. Lebensjahr) und ist laut dem amerikanischen Diagnosesystem geprägt von einem „durchgehenden Muster von Unaufmerksamkeit und/oder Hyperaktivität-Impulsivität“. Es wird zwischen dem vorwiegend unaufmerksamen Erscheinungsbild, dem vorwiegend hyperaktiv-impulsivem Erscheinungsbild und dem gemischten Erscheinungsbild unterschieden. ADHS tritt in den meisten Kulturen bei ca. 2,5% der Erwachsenen auf.
Zum Bereich der Unaufmerksamkeit gehören Symptome wie das häufige Nichtbeachten von Einzelheiten oder Flüchtigkeitsfehler machen, Anweisungen anderer oft nicht vollständig durchführen, Schwierigkeiten, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren, leichte Ablenkbarkeit durch äußere Reize, etc.. Davon müssen von den beschriebenen Symptomen bei Jugendlichen und Erwachsenen ab 17 Jahren mindestens 5 für eine Diagnosestellung auftreten und das durchgehend über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten und in einem Ausmaß, welches nicht dem normalen Entwicklungsstand der Altersgruppe entspricht.
Zum Bereich der Hyperaktivität und Impulsivität gehören Symptome wie häufiges Aufstehen in Situationen, in denen Sitzenbleiben erwartet wird, häufiges „Auf dem Sprung sein“ oder Handeln, als wäre man „getrieben“, häufiges übermäßiges Reden oder häufiges Unterbrechen oder Stören von anderen, etc., wobei auch hier mindestens 5 Symptome über mindestens 6 Monate dauerhaft und in einem von der Norm abweichenden Ausmaß auftreten müssen, um die Kriterien für eine Diagnosestellung zu erfüllen. Bei Erwachsenen kann sich die Hyperaktivität auch als extreme Rastlosigkeit äußern oder dazu führen, dass andere durch die Aktivität bis zur Erschöpfung strapaziert werden. Die Impulsivität äußert sich hauptsächlich in übereilten und unüberlegten Handlungen, die ein hohes Risiko mit sich bringen, sich selbst zu schädigen. Auch starke Stimmungsschwankungen bzw. Schwierigkeiten mit der Emotionsregulation, eine geringe Frustrationstoleranz und schnelles reizüberflutet sein sowie Schwierigkeiten im Umgang mit stressigen Situationen können bei Erwachsenen mit ADHS auftreten, was negative Auswirkungen, etwa auf die Gestaltung von sozialen Beziehungen haben kann.
Wichtig ist es, zu beachten, dass die Symptome nicht ausschließlich als ein Ausdruck von oppositionellem Verhalten, Trotz, Feindseligkeit oder der Unfähigkeit, Aufgaben oder Anweisungen zu verstehen sein dürfen. Außerdem bestehen sie grundsätzlich in mehreren Lebensbereichen (z.B. nicht nur auf der Arbeit, sondern auch im Privatleben) und wirken sich störend auf die Lebensqualität bzw. das Funktionsniveau der betroffenen Person aus.
Haben jetzt plötzlich alle ADHS?
In sozialen Medien, vor allem auf TikTok werden unter dem Hashtag #mentalhealthtips massenhaft Videos zu ADHS geteilt, die Tipps zur Selbstdiagnose und zahlreiche Informationen rund um mentale Gesundheit im Allgemeinen enthalten.
„Das ist doch super! Mehr Aufklärung und Sensibilität, frühere Diagnosestellung, schnellere Hilfe!“, könnte man jetzt denken. Das ist jedoch nur ein Teil der Medaille. Denn über die Hälfte der Videos zu ADHS, die auf TikTok geteilt werden, enthalten Falschinformationen; das hat eine im März 2025 im Fachmagazin PLoS ONE veröffentlichte Studie herausgefunden. Es wurden knapp 100 beliebte unter dem Hashtag #ADHD veröffentlichte Videos untersucht. Die meisten davon enthielten Aussagen zu möglichen Symptomen von ADHS, aber kaum, falsche oder keine Informationen zu Therapiemöglichkeiten oder dem Umgang mit der Erkrankung. Darüber hinaus enthielten mehr als 50% der analysierten Videos Beschreibungen von Symptomen, die gar nicht zum Störungsbild von ADHS gehören.
Natürlich ist dieser „Hype“ um ADHS bei Erwachsenen in den sozialen Medien nicht nur negativ. Mehr Bewusstsein für das Störungsbild kann zur Entstigmatisierung beitragen, Menschen trauen sich, über ihre Probleme zu sprechen und suchen sich möglicherweise endlich die Unterstützung, die sie schon seit Jahren bräuchten.
Demgegenüber bringt der Trend aber auch seine Schattenseiten mit sich. Es erscheint zunehmend, als würde sich ADHS zu einer Art „Modediagnose“ entwickeln, von der es cool oder witzig ist, sie zu haben. Das Auftreten der Störung wird dabei hochgradig überschätzt und Personen, die vorübergehende und ganz normale, beispielsweise stressbedingte Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit oder Unruhe verspüren, haben viel schneller das Gefühl, ADHS zu haben. Die Beschäftigung mit den (vermeintlichen) Symptomen, führt dann erst recht dazu, dass sie sie auch vermehrt wahrnehmen.
Fachpersonen hingegen verdrehen oftmals leider(!) schon die Augen, wenn eine Person mit den Worten „Ich glaube, ich habe ADHS“ in die Praxis kommt, was dazu führen kann, dass man weniger ernst genommen wird. ADHS-Ambulanzen sind derzeit zumeist völlig überlastet. An der Uniklinik in Leipzig ist beispielsweise sogar inzwischen die Warteliste geschlossen, weil der Andrang so groß ist. So führt der Trend dazu, dass Personen, die wirklich Unterstützung brauchen, diese oft erst nach Monaten oder sogar Jahren des Wartens bekommen, weil zahlreiche irreführende TikTok Videos dazu geführt haben, dass normales Erleben und Verhalten als pathologisch betrachtet wird und dadurch gesunde Personen die Ambulanzen mit Diagnostik-Anfragen „fluten“. Das öffnet wiederum die Türen für teilweise unseriöse oder sehr teure Angebote im Internet, die eine schnelle und einfache ADHS-Diagnostik versprechen.
Informationen aus sozialen Medien können also lediglich ein Denkanstoß sein, wenn man Leidensdruck verspürt, der nun endlich erklärbarer wird – aber nicht mehr. Die Diagnose sollte immer unbedingt in die Hände einer Fachkraft. Warum? Weil die Quellen auf TikTok und Co. oft ungeprüft sind und irreführend sein können, da dort grundsätzlich die korrekte Zuordnung zu verschiedenen möglichen Störungsbildern oder dem ganz normalen Erleben und Verhalten und die Einordnung in den Kontext der Person fehlt. Auch für Fachpersonen ist es allerdings gar nicht so einfach, ADHS im Erwachsenenalter korrekt zu diagnostizieren. Das hat mehrere Gründe.
Warum ist die Diagnosestellung im Erwachsenenalter so schwierig?
Die Hyperaktivität, wie man sie direkt bei einem Stereotyp eines „ADHS-Kindes“ im Kopf hat, steht bei Erwachsenen häufig nicht im Vordergrund oder wird sehr gut von der betroffenen Person überspielt. Denn oft äußert sich die Hyperaktivität bei Erwachsenen nicht in sichtbarer motorischer Unruhe, wie z.B. Zappeln, sondern in starker innerer Unruhe, die von außen kaum zu sehen ist.
ADHS im Erwachsenenalter wird außerdem bei männlichen (gelesenen) Personen etwa 6-mal häufiger diagnostiziert als bei weiblichen (gelesenen), da das typische Bild des impulsiven „Zappelphilipp“ oftmals nicht zu der weiblichen, mehr von Unaufmerksamkeit als von Hyperaktivität geprägten Erscheinungsform von ADHS passt. Und dazu schwanken die Ausprägungen der Symptome auch noch teilweise stark mit dem Menstruationszyklus.
Zudem ist es schwierig, bestimmte Kriterien, die für eine Diagnosestellung nötig sind, nämlich der Beginn im Kindesalter und die Auswirkung auf mehrere Lebensbereiche, einzuschätzen. Die Bestimmung des Störungsbeginns in der Kindheit ist oft nur schwer möglich, weil Erinnerungen an Symptome in der Kindheit eher unzuverlässig sind. Da man als Fachperson die hilfesuchende Person nur in einer einzigen Situation, nämlich in der Praxis oder in der Klinik sieht, ist es außerdem nicht möglich, selbst einzuschätzen, ob die Symptome sich in mehreren Lebensbereichen zeigen. Daher wird empfohlen, sich Informationen aus anderen Quellen bzw. von anderen Personen einzuholen, beispielsweise von Angehörigen.
Darüber hinaus gibt es bislang keinen eindeutigen biologischen Marker, anhand dem ADHS diagnostiziert werden kann, z.B. bestimmte sichtbare Veränderungen im zentralen Nervensystem, wie sie bei anderen Störungsbildern auftreten. Es lässt sich also „nur“ anhand der Symptome diagnostizieren. Das wird über das Anamnesegespräch, standardisierte Interviews, Fragebögen oder klinisch-psychologische Tests gemacht. Auch eine körperliche Untersuchung durch Psychiater*innen oder andere Fachärzt*innen ist Teil der Diagnostik, damit andere Erkrankungen ausgeschlossen werden können.
Da die Symptome von ADHS aber häufig auch bei anderen psychischen Störungen auftreten und ADHS bei Erwachsenen oft mit weiteren Erkrankungen gemeinsam auftritt, ist es wichtig, genau hinzuschauen. Wir nennen das Differenzialdiagnostik. Beispielsweise können auch bei der Autismus-Spektrum-Störung, bei Lernstörungen, Angststörungen, Depressionen, Persönlichkeitsstörungen oder Substanzkonsumstörungen mehrere Symptome auftreten, die so ähnlich wirken, wie ADHS. Manchmal kann es also zu Verwechslung mit anderen psychischen Störungen kommen, oder bestehende weitere Diagnosen können nur schwierig erkannt werden. Hier ist also Geduld und eine ehrliche transparente Kommunikation gefragt.
Was sollte ich beachten, wenn ich glaube, ADHS zu haben und welche Hilfe gibt es?
Zunächst dürfen Sie ihre Empfindungen und vielleicht auch Sorgen ernst nehmen. Dieser Blogbeitrag kann Ihnen dabei helfen, eine erste grobe Orientierung zu bekommen und ihre bisherigen Informationsquellen kritisch zu reflektieren. Der erste Schritt ist dann der Gang zur/m Hausärzt*in oder Psychiater*in. Dort können Sie ihre Probleme in einem vertraulichen und professionellen Rahmen erstmals ansprechen und es können körperliche Ursachen ihrer Probleme abgeklärt und ausgeschlossen werden. Sollten Sie bei einer Fachperson das Gefühl haben, überhaupt nicht ernst genommen zu werden, dann empfehle ich Ihnen, eine weitere Praxis aufzusuchen, auch wenn es oft mühsam und mit langen Wartezeiten verbunden ist, einen Termin zu bekommen.
Sie bekommen dann als nächstes eine Überweisung zur/m Psychotherapeut*in (oder Psychiater*in) für die Diagnostik. Manchmal ist es auch möglich, einen Termin in einer speziellen ADHS-Ambulanz zu bekommen. Diese sind meist an Kliniken angegliedert und auf die Diagnostik von ADHS bei Erwachsenen spezialisiert. Die Aufnahmekriterien sind regional unterschiedlich. Ich empfehle Ihnen, sich für ihre Region zu informieren und bei ihrer/m Ärzt*in nachzufragen. Sowohl in den Ambulanzen als auch in den Praxen niedergelassener Psychotherapeut*innen, die mit den Krankenkassen abrechnen können, sind die Wartezeiten oft lang. Trotzdem lohnt es sich, dranzubleiben.
Wenn Sie finanziell gut aufgestellt sind, könnten Sie es auch in Erwägung ziehen, die Diagnostik privat zu finanzieren. Achten Sie dabei aber unbedingt darauf, dass Sie vorher bei einer/m Ärzt*in waren und dass die Person qualifiziert ist und den Ablauf sowie die Kosten einer Diagnostik transparent macht. Qualifikation ist von Laien oft nur schwer zu beurteilen. Eine Approbation als Psychotherapeut*in und Mitgliedschaften in einschlägigen Berufsverbänden, z.B. dem BDP (Bund deutscher Psycholog*innen) sind gute Zeichen.
Wenn dann nach mehreren diagnostischen Sitzungen tatsächlich eine ADHS-Diagnose gestellt wird, gibt es mehrere Behandlungsmöglichkeiten. Bei Erwachsenen hat sich beispielsweise die kognitive Verhaltenstherapie und auch die medikamentöse Behandlung in den letzten Jahren bewährt und wird häufig eingesetzt. Ergänzend können Entspannungsverfahren und weitere hilfreiche Methoden zum Einsatz kommen, um die Symptome zu lindern, die Kompetenzen der Emotionsregulation, des Problemlösens und der Alltagsbewältigung zu verbessern und Ressourcen zu stärken. Personen mit ADHS haben nämlich auch Stärken, die andere oft nicht haben. Beispielsweise sind viele Menschen mit ADHS besonders empathisch und kreativ.
Fazit: ADHS im Erwachsenenalter ist keine reine Modeerscheinung, sondern eine ernstzunehmende, oft lange übersehene Realität für viele Betroffene. Zwischen dem berechtigten Wunsch nach mehr Aufklärung und den Risiken von Fehlinformationen liegt ein schmaler Grat. Umso wichtiger ist es, sich nicht vorschnell verunsichern zu lassen, sondern informiert, kritisch und geduldig den eigenen Weg zu gehen. Wenn Sie das Gefühl haben, etwas passt nicht, dann dürfen Sie sich und ihre Wahrnehmung ernstnehmen. Holen Sie sich Unterstützung und setzen Sie dabei auf eine fundierte Diagnostik und professionelle Begleitung. Und vor allem: Vergessen Sie nicht, dass hinter jeder Diagnose eine ganz individuelle Person mit unterschiedlichsten Stärken, Fähigkeiten und Potenzialen steckt.
Geschrieben von Elli Kutscha
Wenn Du gerade in einer Krise steckst, eine schwierige Zeit durchmachst oder wenn es dir grundsätzlich nicht gut geht, dann können dein:e Hausärzt*in, eine Beratungsstelle in ihrer Nähe oder auch die Telefonseelsorge (rund um die Uhr und auch per Chat erreichbar unter 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222) erste Anlaufstellen sein. Solltest du dich in akuter Gefahr befinden, zögere nicht, den Notruf 112 zu wählen.
Quellen:
Apotheken Umschau (Hrsg.) (2025). Neue Recherche bestätigt: Hälfte der TikTok-Videos zu
mentaler Gesundheit enthält falsche Fakten. Abgerufen am 08.07.2025 von
https://www.apotheken-umschau.de/news/tiktok-haelfte-der-adhs-videos-enthaelt-
falsche-informationen-1253179.html
Falkai, P. & Wittchen, H.-U. (Hrsg.) (2018). Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer
Störungen DSM-5® (2., korrigierte Auflage). Hogrefe.
Karasavva, V., Miller, C., Groves, N., Montiel, A., Canu, W. & Mikami, A. (2025) A double-edged
hashtag: Evaluation of #ADHD-related TikTok content and its associations with
perceptions of ADHD. PLoS ONE 20(3): e0319335.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0319335
Kerchner, J. (Hrsg.) (2025). ADHS bei Erwachsenen. Abgerufen am 08.07.2025 von
https://www.360grad-psychotherapie.de/adhs-erwachsene/
NDR (2025, 18 Februar). Habe ich ADHS? Schnelldiagnosen auf TikTok & Co. [Video]. ARD
Mediathek. Abgerufen am 08.07.2025 von https://www.ardmediathek.de/video/das/
habe-ich-adhs-schnelldiagnosen-auf-tiktok-und-co/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS8wNDA
1Zjc2Ny1mZTQzLTQ1YTQtOGU5NC1lMjcxOWJiNzJiNzU
Universitätsklinikum Leipzig (Hrsg.) (2025). Ambulanz für Erwachsene mit
Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Abgerufen am 08.07.2025 von
https://www.uniklinikum-leipzig.de/einrichtungen/psychiatrie-psychotherapie/ Seiten/
ambulanz-adhs.aspx